
FHD
Familienverbund
Herz-Jesu Dielfen
Aktualisiert am Sonntag, den 08.01.06
12°°Uhr
Sternsingeraktion 2006
Nach einem bewegenden Festhochamt sendete unser Pfarrer Hans-Rudolf Pietzonka am
08. Jan 2006 die Sternsinger seiner Gemeinde nach Nieder- und Oberdielfen aus. Kinder helfen Kinder, die Geschichte des Sternsingens ist eine einzigartige "Erfolgsgeschichte", machte er in seiner Predigt deutlich.

Die Sternsinger aus Niederdielfen im Jahr 2006
 |
 |
|
Die Sternsinger aus Niederdielfen sind zum größten Teil Messdiener in unserer Gemeinde. |
Ältere Messdiener stehen den jüngeren Sternsinger hilfreich zur Seite. |

Zur
Geschichte der Aktion Dreikönigssingen
Am Anfang stand eine Idee, geworden ist daraus die weltweit größte Aktion von
Kindern für Kinder. An der ersten Aktion 1959 beteiligten sich Sternsinger in
100 Pfarrgemeinden und sammelten rund 45.000 EURO. Seit 1961 beteiligt sich der
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) an der Aktion, die seitdem vom
Kindermissionswerk "Die Sternsinger"® und vom BDKJ gemeinsam getragen
wird. Aus den bescheidenen Anfängen ist die weltweit größte Aktion von
Kindern für Kinder gewachsen, an der sich in den vergangenen Jahren jeweils
rund 500.000 Kinder und Jugendliche und rund 100.000 ehren- und hauptberufliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Pfarrgemeinden in der Bundesrepublik
Deutschland beteiligt haben. In den mehr als 40 Jahren ihres Bestehens wurden
durch die Aktion über 28.000 Projekte unterstützt und ca. 310 Millionen EURO
gesammelt.
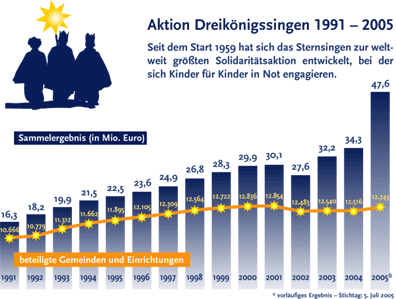
Die Sternsinger bringen Bundespräsident Köhler den Segen

Pünktlich zum Dreikönigsfest am 6. Januar brachten 100 Sternsinger aus dem Bistum Görlitz den Sternsingersegen auch zu Bundespräsident Horst Köhler. Nach einem kleinen Empfang im Bundespräsidialamt schrieben die Mädchen und Jungen aus der Pfarrgemeinde St. Maria Himmelfahrt in Wittichenau den aktuellen Segen „20*C+M+B+06“ über den Diensteingang des Bundespräsidenten am frisch renovierten Schloss Bellevue an.Begleitet wurden die Mädchen und Jungen aus der Lausitz von Msgr. Winfried Pilz, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, und Pfr. Andreas Mauritz, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die das Dreikönigssingen bundesweit verantworten.
Aktion Dreikönigssingen 2006 in Görlitz eröffnet

„Hiermit ist die 48. Aktion Dreikönigssingen offiziell eröffnet!“ Mit dem gemeinsam gesprochenen Schlusssatz gaben Msgr. Winfried Pilz, Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, und Pfr. Andreas Mauritz, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), am Mittwoch, 28. Dezember, in Görlitz den offiziellen Startschuss für die Sternsinger. Bischof Rudolf Müller sprach dazu den Segen.
520 Sternsinger hatten zuvor einen bunten Sternsingertag in der östlichsten Stadt Deutschlands erlebt. Im Mittelpunkt der Eröffnung stand das Leitwort der kommenden Aktion: „Kinder schaffen was!“ Dazu trugen auch vier Gäste aus dem Beispielland Peru bei, die den deutschen Mädchen und Jungen einiges von ihrem Engagement für die arbeitenden Kinder in ihrem Heimatland erzählten.
Bundeskanzlerin Angela Merkelempfängt Sternsinger

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfing am Dienstag, 20. Dezember, traditionell die Sternsinger im Bundeskanzleramt. 112 kleine Königinnen und Könige vertraten in Berlin die rund 500.000 Kinder und Jugendlichen, die rund um den Jahreswechsel wieder von Tür zu Tür ziehen, Christus Segen bringen und für Not leidende Gleichaltrige in aller Welt sammeln werden. Jeweils vier Sternsinger aus allen deutschen Diözesen sowie eine Gruppe aus dem belgischen Hauset trugen der Bundeskanzlerin ihre Lieder vor und präsentierten Leitwort und Beispielland der 48. Aktion Dreikönigssingen.
______________________________________________
Von
Sterndeutern und Sternsingern – Zwölf Fragen und Antworten
1. In der Bibel steht nichts darüber,
daß Könige Jesus besucht haben. Es ist aber von Magiern und Sterndeutern die
Rede. Was waren das für Männer?
Sterndeuter gab es schon vor drei- bis viertausend Jahren. Es waren sehr
gelehrte und weise Männer, die den Lauf der Sterne erforschten und deuteten. In
Persien wurden sie auch Magier genannt. An den Königshöfen übten sie damals
großen Einfluß auf die Entscheidungen und Urteile der Herrscher aus. Sie waren
nämlich in der Lage, den Stand der Sterne, aber auch Sonnen- und
Mondfinsternisse mit großer Genauigkeit vorauszusagen. Zugleich wußten sie den
Stand der Gestirne als Vorzeichen für das künftige Geschick der Menschen zu
deuten. So trauten ihnen viele Menschen damals besondere und wunderbare Kräfte
zu. Sie waren aber keine Zauberer, sondern Gelehrte.
2. Woher kamen die Sterndeuter/Magier?
Im Matthäus-Evangelium heißt es: Sie kamen aus dem Morgenland. Damit könnte
Babylonien/Mesopotamien gemeint sein. Vieles spricht für einen Ort im heutigen
Irak oder sonstwo am persischen Golf: In einer alten Keilschrift von dort heißt
es: „... dann wird ein großer König im Westland aufstehen, dann wird
Gerechtigkeit, Friede und Freude in allen Ländern herrschen und alle Völker
beglücken.“ Unter "Westland" verstanden die Babylonier damals Palästina.
3. Mit welcher Erwartung und mit
welcher Absicht kamen die Sterndeuter?
1925 entzifferte man die Keilschrift einer Tontafel aus dem 3. Jahrtausend vor
Christus aus Sippar am Euphrat: die Berechnungen der Sternforscher für eine
besondere Stellung der Planeten Jupiter und Saturn im Sternzeichen der Fische für
das Jahr 7 vor Christus. Jupiter galt als Planet des Weltherrschers, das
Sternbild der Fische wurde als Zeichen der Endzeit betrachtet; der Planet Saturn
war der Stern Palästinas. Wenn Jupiter dem Saturn im Zeichen der Fische
begegnet, so bedeutet das: In Palästina wird in diesem Jahr der Herrscher der
Endzeit erscheinen. Mit dieser Erwartung kamen die Sterndeuter, von denen die
Bibel erzählt, nach Jerusalem. Sie wollten dem Weltenherrscher huldigen, dessen
Geburt sie aus den Sternen klar erkannt hatten.
4. Wie viele waren es?
Wie viele Sterndeuter nach Betlehem kamen, wissen wir nicht. Auf alten Bildern
sind z.B. vier Magier zu sehen, auf dem ältesten uns überlieferten Bild nur
zwei. In einigen frühchristlichen Kirchen sind einmal sogar zwölf Magier zu
sehen. Der Kirchenlehrer Origenes (185-254) spricht zum ersten Mal von drei
Magiern, wohl wegen der drei Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe.
5. Warum schenkten sie Gold, Weihrauch und Myrrhe?
Für die Sterndeuter war der Messias Gott und König. Darum brachten sie ihm
entsprechende Geschenke: Gold für den König, Weihrauch für Gott und Myrrhe für
den sterblichen Menschen. Schon im 2. Jahrhundert wurden die Geschenke als
Symbole für die Person Christi verstanden: Er war König, Gott und Mensch.
6. Warum wurden aus den Sterndeutern Könige?
Im 6. Jahrhundert wurden aus den Sterndeutern Könige. Man nahm an, daß nur Könige
Königsgeschenke überreichen können. So las man es auch in den alten
Weissagungen der Bibel über das Kommen des Messias: „Die Könige von Tharsis
werden Geschenke opfern; die Könige von Arabien und Saba werden Gaben
darbringen ... es werden ihn alle Könige der Erde anbeten, alle Völker ihm
dienen“. Auf Bildern sind die Magier seit dem 10. Jahrhundert als Könige
dargestellt.
7. Was bedeuten die Namen?
In der Bibel werden die Namen nicht genannt. Sie tauchen erst im 6. Jahrhundert
auf: Melichior, Bithisarea und Gathaspa. Es dauerte 300 Jahre, bis daraus die
heute bekannten Namen Caspar, Melchior, Balthasar wurden.
Caspar bedeutet Schatzmeister (persisch). Er soll Weihrauch zur Krippe gebracht
haben.
Melchior heißt: König des Lichtes (hebräisch). Er trug das Gold zur Krippe.
Balthasar bedeutet in der aramäischen Sprache: Gott schütze das Leben des Königs.
Er brachte die Myrrhe.
Im Mittelalter wurde Caspar häufig als Jüngling, Melchior als Mann der
Lebensmitte und Balthasar als Greis dargestellt. Oft sind sie zugleich die
Vertreter der damals bekannten Erdteile.
8. Wer ist der schwarze König?
In der Heimat der Magier am persischen Golf gab es wohl keinen mit schwarzer
Hautfarbe. Erst im Mittelalter vertritt einer der Könige – meist ist es
Caspar – den „schwarzen Erdteil“ und wird als Mohrenkönig dargestellt.
9. Warum wurden die Drei Könige als Heilige verehrt?
Die Sterndeuter-Könige sind sicher Vorbilder für jeden Christen. Sie brachten
den Mut auf, sich auf den Weg zu machen. Sie vertrauten dem Stern und waren die
ersten Heiden, die an der Krippe niederknieten.Das Fest der Hl. Drei Könige am
6. Januar heißt eigentlich Epiphanie, d.h. das Aufscheinen Gottes vor allen Völkern;
sie waren in den Königen vertreten, die dem einen Herrn der Welt huldigten.Ihre
Verehrung erlebte im 9. Jahrhundert in Mailand einen Höhepunkt. Als dann die
Gebeine der Heiligen nach Köln überführt und in einem goldenen Schrein
beigesetzt wurden, zogen die Gläubigen in großen Scharen dorthin; seine
wundertätige Kraft galt als grenzenlos. Kranke berührten ihn und hofften auf
Heilung. Von Köln aus breitete sich die Verehrung der Heiligen Drei Könige über
ganz Nordeuropa aus. Sie wurden die Patrone der Wallfahrer und Wanderer. Auf den
Wallfahrtswegen entstanden viele Gaststätten mit den Namen, „Drei
Könige”, „Stern”oder
„Mohr”.
10. Welche Bräuche gibt es rund um den Dreikönigstag?
Von den einstigen Bräuchen um das Dreikönigsfest sind nur noch wenige übriggeblieben.
Ursprünglich waren sie eng mit den Neujahrsbräuchen verquickt. Mit der
Anrufung der Könige verband man einen Abwehrsegen gegen alles Unheil für Haus
und Hof im kommenden Jahr. Dazu wurden die Anfangsbuchstaben ihrer Namen auf die
Türbalken geschrieben. Mancherorts wurden Stall und Haus mit Weihrauch ausgeräuchert
und mit Dreikönigswasser besprengt.In Italien bekommen die Kinder ihre
Geschenke nicht an Weihnachten, sondern am Dreikönigstag von einer guten Fee,
Befana, geschenkt.In einigen Gegenden Frankreichs und der Schweiz gibt es den
Brauch des „Bohnenkönigs“. Eine Bohne, Mandel oder Trockenpflaume wird in
einen Kuchen eingebacken. Wer beim Kuchenessen am Morgen des Dreikönigstages
den eingebackenen Gegenstand „erwischt”,
darf an diesem Tag als König die Familie „regieren”.
11. Seit wann gibt es den Brauch des
Sternsingens?
Das Sternsingen ist ein alter Brauch, der bis ins Mittelalter zurückreicht.
Zuerst wurde er in Klöstern und Gymnasien von Bischofsstädten bekannt. Als Könige
verkleidet, zogen Jungen durch die Gassen und spielten den Zug zur Krippe nach.
Der Stern, den sie bei sich trugen, mußte beim Singen immer gedreht werden. Er
war ein Symbol für das Sonnenrad, das – so glaubte man damals – in den sog.
zwölf heiligen Nächten zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag
stehengeblieben war.
Das Kindermissionswerk/Die Sternsinger® hat den Brauch 1958 durch die
Sternsingeraktion wieder aufgegriffen und ihm ein neues Ziel gegeben: Die
Spenden der Aktion sind für Kinder in Not in der Dritten Welt bestimmt.
12. Was bedeuten die Buchstaben, die
die Sternsinger an die Türen schreiben?
Die Sternsinger schreiben die jeweilige Jahreszahl und die Buchstaben C + M + B
an die Türen. Das sind die Anfangsbuchstaben für einen Segen in lateinischer
Sprache: Christus Mansionem Benedicat, d.h. Christus möge dieses Haus segnen.