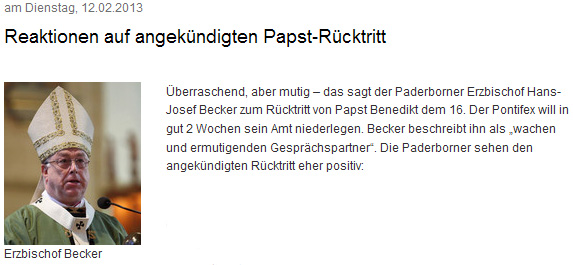
FHD
Familienverbund
Herz-Jesu Dielfen
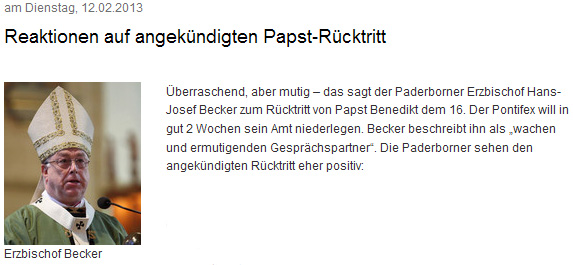
Quelle: Der Dom (7.02.13)

Jetzt sind wir bald kein Papst mehr: Der Amtsverzicht von Papst Benedikt XVI. kam plötzlich, letztlich aber nicht ganz überraschend. Der 85-Jährige sah, dass seine Kräfte zunehmend schwinden. Und vielleicht auch vor dem Hintergrund des langen und öffentlichen Leidens seines Vorgängers Johannes Paul II. will er die Leitung der Kirche in frischere Hände geben. Mit der ihm eigenen Klarheit hat er am vergangenen Montag seinen Rücktritt zu einem genau fixierten Termin angekündigt: für den 28. Februar, 20.00 Uhr.
von Christoph Arens und Johannes Schidelko
Mit dieser Ankündigung hat Benedikt XVI. in seiner Heimat Erschütterung, Überraschung und auch Bewunderung ausgelöst.
Drei Mal hat Benedikt XVI. die Bundesrepublik besucht: 2005 zum Weltjugendtag in Köln, 2006 seine Heimat Bayern und 2011 zum offiziellen Staatsbesuch in Berlin, anschließend Erfurt und Freiburg. Bei aller Begeisterung: Der deutsche Papst wurde zuhause besonders kritisch beobachtet. Zugleich wurde das Oberhaupt von 1,2 Milliarden Katholiken im Ausland immer auch als Deutscher gesehen.
Schon bei der Papstwahl am 19. April 2005: Während die „Bild“-Zeitung „Wir sind Papst“ jubelte, titelten britische Boulevardzeitungen „Panzerkardinal“. Auch bei seinen Besuchen in Israel und Auschwitz stand Benedikt XVI. als „Sohn des deutschen Volkes“ unter Beobachtung. Meist allerdings gab es positive Reaktionen – sodass der Philosoph Peter Sloterdijk von einem historischen Einschnitt sprach: „Ein deutscher Name kann wieder ein Integritätssymbol höchsten Niveaus darstellen“, betonte er.
Wie kaum einer seiner Vorgänger hat der brillante Theologe und scharfsinnige Analytiker Joseph Ratzinger die geistige Auseinandersetzung mit der Zeit geführt und forciert. Er wirkte vor allem mit seinem Wort, mit seinen geschliffenen Ansprachen und Dokumenten. Er wollte den Gläubigen Freude am Glauben und an der Kirche vermitteln. Seine großen Reden vor Politikern und Denkern in Paris, London, Berlin oder vor der UNO fanden höchste Anerkennung. Er verstand sich weniger auf spektakuläre Gesten wie zuvor der polnische Papst, auch wenn ihm bei seinen Auslandsreisen, aber auch in Rom, die Menschenmassen zujubelten.
Benedikt XVI. wollte die Kirche nach dem Konzil und den bewegten Jahren unter Johannes Paul II. wieder in ein ruhigeres Fahrwasser bringen. Zu den Hauptanliegen dieses Pontifikates gehörte es, die vielen Aufbrüche der vergangenen Jahre zu vertiefen, theologisch auszuloten und abzusichern.
Er akzentuierte manches anders als sein Vorgänger, insbesondere in der Debatte um das Erbe des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965). Aufbrüche und neue Ideen sollen ins Gesamtgeflecht der Kirche und ihrer Tradition eingeordnet werden.
Das Konzil ist für ihn nicht Bruch, sondern eine Etappe in der 2000-jährigen Kirchengeschichte. Dazu gehörte auch sein Bemühen um eine Aussöhnung mit den Traditionalisten der Piusbruderschaft. Durch eine breitere Einführung der „alten Liturgie“ von 1962 wollte er ihnen entgegenkommen.
Seit 1981 lebte Joseph Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation in Rom. Er sei aber immer sehr gut über Deutschland informiert, berichtete der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch. Und er hat wahrgenommen, dass die Bundesbürger ihn besonders intensiv unter die Lupe nehmen.
Mit der Papstwahl schienen viele Konflikte vergessen. Der bescheiden auftretende Bayer entwickelte einen ganz eigenen Charme, etwa als er auf dem Weltjugendtag in Köln mit einer Million Menschen den wohl größten Gottesdienst in Deutschland feierte.
Bittere Zeiten musste Benedikt XVI. 2009 durchleben, als aus der Rücknahme der Exkommunikation für die Piusbrüder-Bischöfe ein medialer Super-Gau entstand: Denn unter ihnen war auch der Holocaust-Leugner Richard Williamson. Die folgenden Missdeutungen, Entschuldigungen und Neustrukturierungen hinterließen Schrammen. Allerdings führte dieser Eklat mittelfristig zu einer neuen Versachlichung und in einen theologischen Dialog mit den Traditionalisten.
Noch dramatischer wirkte ein Jahr später die neue Explosion der Missbrauchsskandale. Erst nach Monaten gelang es Rom, die seit 2001 geltende und durch Kardinal Ratzinger angestoßene Rechtslage und die kirchliche Praxis darzulegen.
Ein Ereignis für die Geschichtsbücher war dann der Deutschlandbesuch im September 2011. Eine glänzende Rede im Bundestag, große Gottesdienste in Berlin, Thüringen und Freiburg, ein Treffen mit Missbrauchsopfern – vor allem der Besuch an Wirkungsstätten Luthers in Erfurt und die „Entweltlichungs“-Rede in Freiburg boten Stoff für Debatten. Wie sehr Benedikt XVI. aus deutscher Theologie schöpft, zeigte sich zuletzt, als er den Regensburger Dogmatiker und Bischof Gerhard Ludwig Müller zum obersten Glaubenshüter in den Vatikan berief – jene Position, die er einst selbst bekleidete.
Gefestigt und ausgebaut hat Benedikt XVI. die ökumenischen und interreligiösen Kontakte. Die Beziehungen zum Judentum sind inzwischen so stabil, dass sie auch schweren Belastungen standhalten, wie nach dem Williamson-Skandal oder dem Streit um die Karfreitagsfürbitte. Auch das Verhältnis zum Islam, das nach dem Regensburger Vortrag von 2006 mit dem mohammedkritischen Zitat einen Einbruch erlebte, ist wieder stabiler.
Für seinen Rücktritt hat sich Benedikt XVI. einen Zeitpunkt ausgesucht, an dem sich die Wellen der Erregung wieder etwas geglättet hatten. Denn er wollte, so hatte er in seinem Interview-Buch mit Peter Seewald betont, die Kirche im Fall eines Rücktritts keinesfalls in einer Situation der Gefahr ver-lassen. Benedikt XVI. hat die katholische Weltkirche in einer schwierigen Zeit geführt. Durch ein intensives Arbeits-pensum hat er sich physisch aufgerieben.
Er hatte es mit seiner nüchternen Art des Theologen und Intellektuellen sicher schwerer, die Herzen der Menschen zu erobern, als sein Vorgänger. Durch seinen Intellekt und seine menschliche Bescheidenheit hat er sich dennoch weltweit Anerkennung verschafft. Von daher war seine Amtszeit keinesfalls ein Übergangspontifikat.